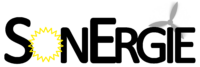Das Bürgerenergiegesetz NRW, welches Ende 2023 vom Landtag NRW beschlossen wurde, bietet Bürgerinnen und Bürgern wie Gemeinden erstmals eine rechtlich verankerte Möglichkeit, bei Windkraft vor Ort finanziell mitzuwirken und zu profitieren. Das Gesetz macht die Beteiligung verpflichtend, nicht mehr freiwillig.
Im Folgenden wollen wir die Grundzüge dieses Gesetzes und die daraus entstehenden Möglichkeiten für Bürger*innen und Gemeinden in einem Überblick möglichst transparent darstellen:
Was ist das Bürgerenergiegesetz?
Das Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an der Windenergienutzung in NordrheinWestfalen (kurz „Bürgerenergiegesetz NRW“ bzw. BürgEnG) ist am 28. Dezember 2023 in Kraft getreten.
Ziel des Gesetzes ist:
- die finanzielle Beteiligung von Bürgerinnen, Bürgern und Gemeinden bei neuen Windenergieprojekten verpflichtend zu machen,
- die Akzeptanz vor Ort zu erhöhen,
- die regionale Wertschöpfung zu stärken, also dass die Vorteile aus Windkraftprojekten auch bei denen ankommen, die in der Nähe leben.
Das Gesetz gilt grundsätzlich für neue, genehmigungsbedürftige Windenergieanlagen nach dem BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG) in NRW sowie auch RepoweringVorhaben (bestehende Anlagen werden vollständig ersetzt).
Es gibt Ausnahmen, etwa sehr kleine Anlagen (unter einer bestimmten Höhe) oder Windenergieanlagen, die Teil eines privilegierten Betriebes im Außenbereich sind.
Wer ist beteiligungsberechtigt?
- Standortgemeinden: Gemeinden, auf deren Gebiet sich mindestens eine der Windenergieanlagen befindet.
- weiter beteiligungsberechtigte Gemeinden: Zusätzlich auch Gemeinden, die sich zumindest teilweise innerhalb eines Radius von 2.500 Metern um die Turmmitte einer Anlage befinden. Diese Gemeinden sind ebenfalls berechtigt.
- Bürgerinnen und Bürger: Natürliche Personen, die in einer beteiligungsberechtigten Gemeinde wohnen (mindestens seit drei Monaten zum Zeitpunkt der Genehmigung der Anlage).
Welche Formen der Beteiligung gibt es?
Das Gesetz sieht vor, dass Projektträger und Standortgemeinden eine Beteiligungsvereinbarung schließen, in der festgelegt wird, wie Gemeinden und Bürger*innen sich beteiligen können. Diese Vereinbarung soll auf die Verhältnisse vor Ort zugeschnitten sein.
Dabei sind grundsätzlich verschiedene Modelle zur Beteiligung möglich. Beispiele sind Gesellschafts- oder Anteilserwerb, vergünstigte Stromtarife, pauschale Zahlungen an Anwohnerinnen und Anwohner, Finanzierung von gemeinnützigen Stiftungen oder Initiativen, Kauf einzelner Windenergieanlagen oder Teile davon.
Wenn keine Einigung rechtzeitig zustande kommt, greift eine sogenannte Ersatzbeteiligungspflicht:
- Die Gemeinde bekommt dann ein Angebot von 0,2 Cent pro Kilowattstunde erzeugten Stroms (oder Äquivalent) vom Betreiber.
- Bürgerinnen und Bürgern muss ein Nachrangdarlehen ab 500 Euro je Anteil angeboten werden, mit attraktiver Verzinsung.
Vorteile für Bürger*innen und/oder die Gemeinde
- Bürger*innen können direkt finanziell profitieren: Durch Beteiligungsmodelle oder Zahlungen, wenn Sie im Umkreis liegen.
- Sie können mitentscheiden, wie Beteiligungsangebote gestaltet sind, z. B. Art der Beteiligung, welche Vorschläge sinnvoll sind vor Ort.
- Ihre Gemeinde erhält Einnahmen, die gemeinwohlorientiert verwendet werden können (z. B. zur Verbesserung der Infrastruktur, für Vereine, lokale Projekte).
- Mehr Transparenz: Sie erfahren frühzeitig von Vorhaben und Beteiligungsoptionen.
Welche Herausforderungen gibt es?
- Auch wenn Beteiligung verpflichtend ist, bleibt Verhandlungsspielraum: Vereinbarungen müssen ausgehandelt werden. Wer nicht gut informiert ist, kann benachteiligt sein.
- Die Höhe der Beteiligung und mögliche Rendite bei Nachrangdarlehen hängt von vielen Faktoren ab (Projektgröße, Standort, Genehmigung, Investitionskosten).
- Aufwand und Komplexität der Beteiligung liegt oft bei Ehrenamtlichen: Beteiligungsverträge, rechtliche und finanzielle Beratung, mögliche Risiko bei Investitionen.
- Nicht alle Projekte fallen unter das Gesetz (z. B. sehr kleine Anlagen, Anlagen zur Eigenversorgung), daher nicht jede Windenergieanlage führt automatisch zu Beteiligungsansprüchen.
Wie hat die Gemeinde Sonsbeck auf das neue Gesetz reagiert?
Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat im Juni Frühjahr 2023 beschlossen, dass eine Bürgerenergiegenossenschaft eine für Sonsbeck passende Form der Bürgerbeteiligung wäre, um lokalen Bürger*innen eine direkte Art der Beteiligung an zukünftigen Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet zu ermöglichen. Ein Gründungszuschuss in Höhe von 15.000 € wurde zur verfügung gestellt. Die seit Januar 2023 bestehende „Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien“ aus Ratsmitgliedern, sachkundigen Bürgern sowie Vertreter*innen der Gemeinde Sonsbeck suchten und fanden interessierte Ehrenamtliche, die die Gründung einer solchen Genossenschaft in Sonsbeck angingen.
Was ist die Rolle der SonErgie e.G. als Bürgerenergiegenossenschaft in Sonsbeck in Verbindung mit dem Gesetz?
Durch die im Februar 2024 gegründete SonErgie e.G. haben potentielle Windkraftanlagenentwickler und –betreiber einen direkten Ansprechpartner, um die gesetzlich verankerte Pflichtbeteiligung der Bürger*innen des Gemeindegebietes Sonsbeck umzusetzen. Somit erfüllen die Betreiber das Gesetz und die SonErgie sorgt dafür, dass zum Einen Bürger*innen von den gebauten Anlagen direkt und auf dem bestmöglichsten Wege profitieren können und zum Anderen auch lokale Betreibergesellschaften den Vorrang vor Großinvestoren geboten wird.
Weiter hat sich die SonErgie e.G. sich zum Ziel gesetzt, die Bürger*innen Sonsbecks transparent während des gesamten Prozesses der Entwicklung, Planung, Errichtung sowie des Betriebes einer Windkraftanlage zu informieren. So sollen eventuelle Bedenken gegen diese Form der Energiegewinnung ausgeräumt und Sonsbeck dem Ziel der Energieautarkie näher gebracht werden.
Darüber hinaus will die SonErgie während des gesamten oben genannten Prozesses zusätzliche Wege fördern und fordern, um die Gemeinde, lokale Initiativen oder Betriebe im größtmöglichen Sinne von geplanten Windkraftanlagen profitieren zu lassen. So sollen Wertschöpfung und Gewinne vor Ort verbleiben.